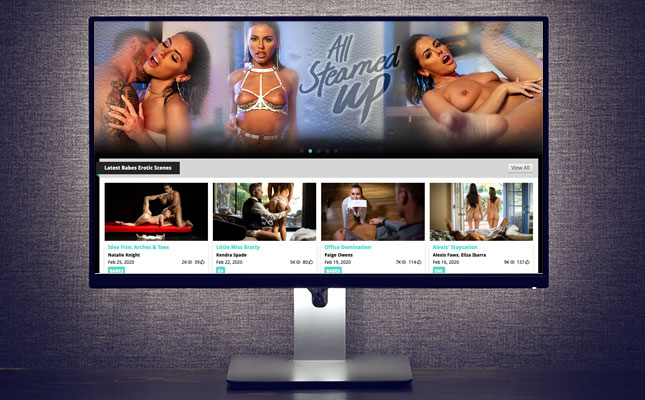Seit Juli 2017 soll das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) Sexarbeiterinnen besser schützen und das Rotlichtgewerbe stärker kontrollieren. Die wichtigsten Regelungen: Für Freier gilt die Kondompflicht, Huren müssen sich anmelden und wer ein Bordell betreiben möchte, muss vorstrafenfrei sein.
Nach knapp 2 Jahren ist nun der Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz: Hat das Gesetz seinen Zweck erfüllt?
Lies auch: Paysex: Zahlen und Fakten zur Prostitution in Deutschland
Überschaubare Anmeldezahlen
Wer als Prostituierte tätig sein möchte, muss sich seit Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes bei den zuständigen Behörden offiziell anmelden. Die bisherigen Zahlen sprechen allerdings dafür, dass viele Sexarbeiterinnen genau das bislang nicht getan haben.
Ein paar Beispiele:
Ende 2018 waren in Hamburg nur knapp 1.000 Sexworker erfasst. Die Behörden vor Ort schätzen jedoch, dass insgesamt 6.000 Menschen in der Hansestadt im Rotlichtgewerbe arbeiten.
In Bremen meldeten sich zu diesem Zeitpunkt von geschätzten 950 Prostituierten nur etwas mehr als 100 an.
Laut Experten arbeiten in ganz Nordrhein-Westfalen rund 42.000 Prostituierte. Im vergangenen Jahr gab es dort jedoch lediglich 7.300 Anmeldungen.
Die Anmeldezahlen sind also überschaubar – aber warum ist das so?
Lies auch: Bordell- und Nutten-Preise: So viel kostet eine Prostituierte
Sorgen und Misstrauen bei vielen Prostituierten
Das Prostituiertenschutzgesetz wurde bereits heftig kritisiert, bevor es in Kraft getreten ist. Ein Hauptkritikpunkt war von Anfang an, dass sich die Huren durch eine Anmeldung „outen“ würden.
Laut der Leiterin der Fachberatungsstelle für Prostitution der Diakonie in Hamburg, Julia Buntenbach-Henke, hat sich dieses Szenario bewahrheitet. Viele Sexworkerinnen gehen der Tätigkeit im Rotlicht ohne das Wissen ihrer Familie und Angehörigen nach. Durch die Behörden-Registrierung wird ihnen die Ausübung dieses Jobs jedoch eindeutig „attestiert“.
Nach der Anmeldung erhalten die Frauen nämlich einen Huren-Ausweis, den sie bei ihrer Arbeit bei sich führen müssen. Auf dem Ausweis können sie zwar einen Alias-Namen verwenden, allerdings sind sie über das Foto identifizierbar.
Noch größer wiegt aber laut Buntenbach-Henke das Misstrauen vieler Prostituierter gegenüber den Behörden. Viele sorgen sich, was mit ihren Daten passiert und dass sie in falsche Hände gelangen könnten.
Ob diese Angst gerechtfertigt ist, lässt sich schwer sagen. Es ist bislang nichts über Pannen oder unsensiblen Umgang mit den Daten seitens der Behörden bekannt. Fakt ist, dass bestimmte Informationen wie Name, Adresse und Geburtsdatum an das Finanzamt weitergeleitet werden – allerdings unterliegen sie dort dem Steuergeheimnis.
Weitere Gründe für die geringe Anmeldezahl sind u. a. der Konsum illegaler Drogen, Sprachprobleme sowie mangelnde Kenntnisse des deutschen Bürokratiewesens seitens der Prostituierten.
Doch auch die Bürokratie selbst dürfte für die wenigen Registrierungen mitverantwortlich sein. In zahlreichen Kommunen war die Anmeldung erst verspätet möglich – bspw. in Bremen aufgrund von Personalmangel erst seit Oktober 2018.
Lies auch: Huren Forum: Die besten Freierforen mit Tests und Bewertungen
Die Folge: Rückzug ins Internet
Ein aktueller Bericht der Landesregierung NRW liefert eine düstere Einschätzung über die Auswirkungen des Gesetzes: „Es ist zu befürchten, dass sich viele Prostituierte ins Dunkelfeld der Prostitution zurückgezogen haben, wo sie für Behörden und Beratungseinrichtungen nur noch schwer zu erreichen sind.“
Sabine Reehs von der Evangelischen Frauenhilfe Westfalen bestätigt diese Einschätzung in einem Bericht auf nw.de und nennt als Dunkelfeld das Internet: „Wir beobachten: Die ziehen sich jetzt ins Internet zurück und bieten ihre Dienste da an.“
Dieser Rückzug von vielen Huren ins Internet könnte im Zusammenhang mit zahlreichen Schließungen von Erotikbetrieben seit der Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes stehen. Dem Bericht der Landesregierung zufolge sind es eben jene Frauen, die dort einst beschäftigt waren und nun ihre Dienste über das Netz anbieten.
Die Portale im Internet bieten dabei einen deutlich ungeschützteren Rahmen als einst die nun geschlossenen Bordelle. Zwar wurden auch Betriebe geschlossen, in denen Ausbeutung und menschenunwürdige Bedingungen herrschten. Allerdings traf es auch zahlreiche etablierte Clubs – diese mussten aufgrund neuer Anforderungen und Bau-Auflagen dicht machen.
#Bordelle bieten nicht automatisch gute #Arbeitsplätze, es hängt vom #Management ab. Wenn im Zuge der #Anmeldepflicht viele Sexworker den Bordellen fern bleiben, verschwinden jedoch viele Adressen inkl guter Arbeitsplätze.
— ^^ (@hauptstadtdiva) May 13, 2019
Damit fielen einige mehr oder weniger „sichere“ Arbeitsplätze weg. Der daraus resultierende Verkauf des eigenen Körpers über das Internet oder auf der Straße ist für Behörden nun noch diffuser und schwerer zu kontrollieren. Gleichzeitig ergeben sich dadurch für Zuhälter und gewalttätige Freier neue Möglichkeiten zur Ausbeutung und Erpressung.
Lies auch: Huren und Nutten finden: Die besten Sexanzeigen Portale
Denen, die wirklich Schutz brauchen, hilft das Gesetz nicht
Unter den beschriebenen Folgen des Prostituiertenschutzgesetzes leiden vor allem Zwangsprostituierte und sogenannte Beschaffungsprostituierte, die mit Sex ihren Drogenkonsum finanzieren.
Für selbstbestimmt arbeitende Huren mit guter Bildung bedeuten die neuen Regelungen vor allem mehr lästige Bürokratie und Kontrolle. Die prekär lebenden Prostituierten dagegen werden durch sie verstärkt in die Illegalität und Armut getrieben.
Dass diese Sexarbeiterinnen durch das Gesetz steuerrechtlich wie gewöhnliche Selbstständige behandelt werden, erscheint angesichts ihrer Lebensrealität abstrus. So sollen die Frauen eine Steuerklärung machen, obwohl sie zum Teil nicht mal der deutschen Sprache mächtig sind, keine Krankenversicherung haben und mit ihrer Drogensucht oder brutalen Zuhältern zu kämpfen haben.
Das Gesetz scheint seinem Namen also nicht gerecht zu werden. „Schutz“ bietet es zumindest für die Huren, die ihn nötig hätten, nicht.
Was den Prostituierten wirklich helfen würde
Zwar ist nicht absehbar, dass der Bund das Prostituiertenschutzgesetz in nächster Zeit überarbeiten wird. Dennoch stellt sich angesichts der anhaltenden Kritik an dem Gesetz die Frage, wie man es besser machen könnte bzw. was den Sexarbeiterinnen wirklich helfen würde.
Im Sinne des Schutzgedankens wäre wohl eine kostenlose Rechtsberatung sinnvoll. Das Wissen, welche Rechte ihnen zustehen und wo sie in schwierigen Situationen Hilfe finden, könnte den Huren beispielsweise bei Preisverhandlungen mit Freiern oder bei einer Konfrontation mit gewalttätigen Zuhältern weiterhelfen.
Mit am wichtigsten wären Sprachkurse, damit die Prostituierten ihre Anliegen artikulieren und sich verteidigen können.
Die derzeit vorgeschriebene gesundheitliche Beratung mag sinnvoll sein. Sie müsste aber durch ein gynäkologisches Untersuchungsangebot ergänzt werden, damit die Gesundheit der Frauen auch praktisch und in akuten Fällen „geschützt“ wird. Dieses Angebot müsste dann ohne Krankenversicherung zugänglich sein – nur so könnten Armuts-Prostituierte davon profitieren.
Dass die bereits geregelte Gesundheitsberatung ihre Berechtigung hat, zeigt ein Beispiel aus Mittelfranken. Dort erschien eine Prostituierte mit Verletzungen zu dem Beratungstermin. Sie öffnete sich im Gespräch mit der Ärztin und berichtete von einem gewalttätigen Freier, der ihr die Wunden zugefügt hatte. Die Ärztin empfahl das Einschalten der Polizei, dem stimmte die Sexarbeiterin zu. Der Freier wurde daraufhin zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt.
Ernüchterndes Fazit
Der bereits erwähnte Bericht aus Nordrhein-Westfalen findet klare Worte für eine Bilanz des Prostituiertenschutzgesetzes nach knapp zwei Jahren: „Es muss bilanziert werden, dass sich nur eine Minderheit der beobachteten Personen durch das ProstSchG geschützt und unterstützt fühlte.“
Dabei stützt sich der Bericht auch auf Befragungen der betroffenen Sexworker selbst. Eine große Mehrheit der Frauen fühlt sich demnach durch das Gesetz nicht geschützt, sondern kriminalisiert und kontrolliert.
Eine Reform des Gesetzes täte daher dringend Not. Am Reformierungsprozess müssten die Prostituierten dann von Anfang an so gut es geht beteiligt werden, damit sich die Regelungen endlich an deren Lebensrealität orientieren. Denn eines hat das bisherige Gesetz gezeigt: Politiker sind offenbar nicht in der Lage, sich in die Welt der Prostitution mit all ihren Handlungsmustern und Funktionsweisen hineinzuversetzen.